Erzählungen (in) der Kriminologie
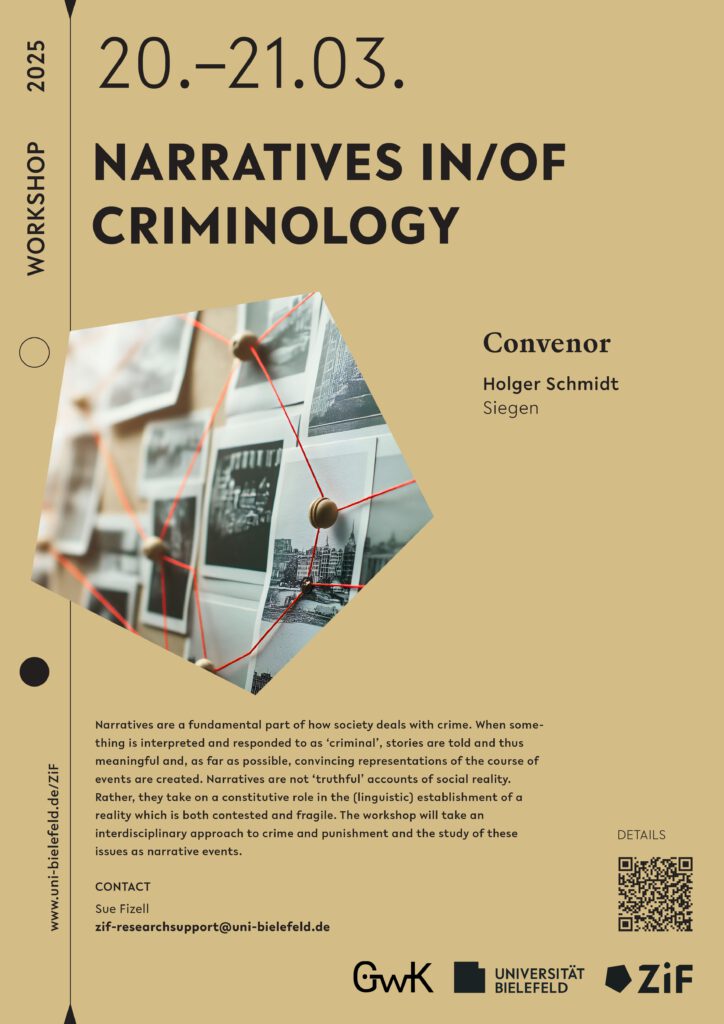
Narrationen bilden einen grundlegenden Bestandteil des gesellschaftlichen Umgangs mit Kriminalität. Wenn etwas als ‚kriminell‘ interpretiert und darauf reagiert wird, werden Geschichten erzählt und damit sinnstiftende und möglichst überzeugende Darstellungen von Ereignisverläufen etabliert. Erzählungen stellen dabei keine ‚wahrheitsgetreue‘ Abbildungen sozialer Wirklichkeit dar, auch wenn sie auf außersprachliche Realität referenzieren. Vielmehr handelt es sich um kontextabhängige und wandelbare Gebilde, die eine konstitutive Rolle in der sprachlichen Konstruktion von Kriminalitätswirklichkeit(en) einnehmen. Ob es sich dabei um polizeiliche Vernehmungen, um Auseinandersetzungen vor Gericht, den politischen Diskurs oder die mediale Berichterstattung über Kriminalität handelt: Stets werden spezifische Abläufe des Ereignisses geschildert, Verantwortlichkeiten be- und zugeschrieben, Rechtfertigungen gesucht und alternative Interpretationen bewertet. Auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Phänomenen der Kriminalität und der Bestrafung lässt sich als eine narrative Form der Wirklichkeitsproduktion fassen. Die Kriminalitätsforschung nutzt nicht nur regelhaft narrativ verfasste Erhebungsmethoden (u.a. Interviews), sondern sie produziert selbst (Wissenschafts‑)Erzählungen: über Begründungszusammenhänge von kriminellem Handeln, über Eskalationsspiralen in Kontrollsituationen oder auch darüber, warum gesellschaftlich überhaupt das Label ‚Kriminalität‘ vergeben wird. Die Erforschung von Kriminalität lässt sich mithin als narratives Geschehen und als machtabhängige Konstitution von Wirklichkeit verstehen.
Die interdisziplinär und international besetzte Tagung (Deutsch/Englisch) widmete sich dieser narrativen Dimension von Kriminalität. Empirische Studienergebnisse wurden dabei unter narrativer Perspektive diskutiert und im Hinblick auf ihre theoretisch-methodologischen Implikationen für die Kriminalitätsforschung analysiert.
Die Tagung wurde am 20.03./21.03.2025 im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF, Bielefeld) realisiert.
Kriminologisches Sommerfest am 01. Juli 2023
an der Humboldt-Universität zu Berlin (Ziegelstraße 4)
im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld
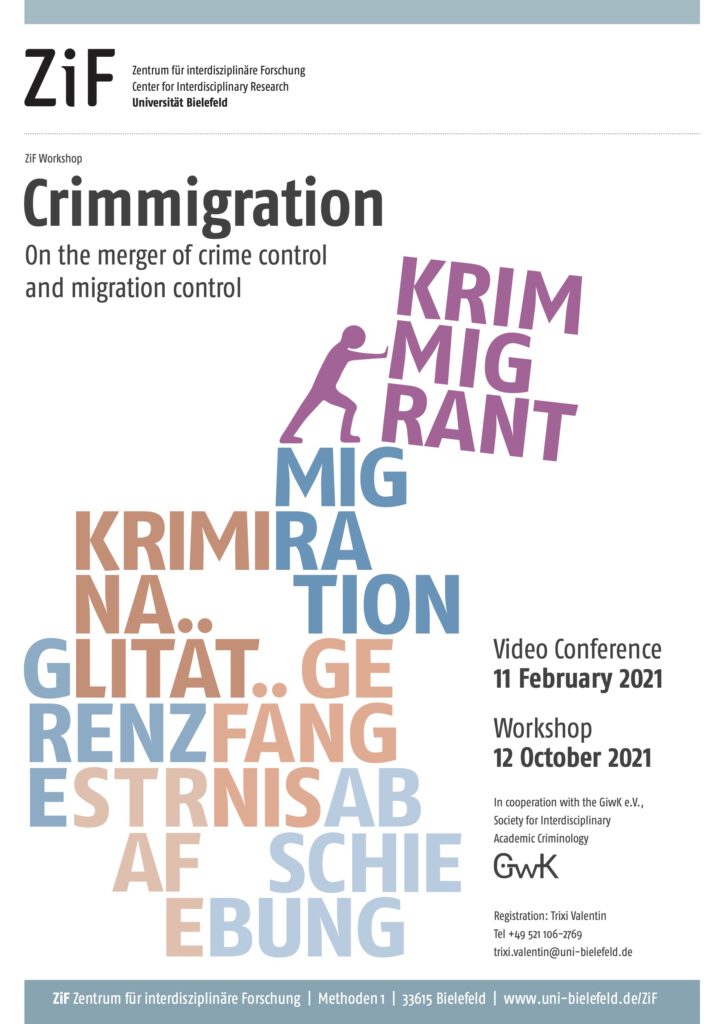
Crimmigration refers to the intersection and increasing amalgamation of two legal arenas that are still considered as separate in legal theory: The merger of criminal law and migration law, of crime control and migration control. Crimmigration is at the same time cause and consequence of a societal discourse in which the construction of migration, of the foreign and the other, comes along with constructions of crime, insecurity and danger. With respect to the law in action, an important consequence is the loss of procedural guarantees, with respect to discursive practice a substantial identification of the criminal with the foreign. This conference will initiate the necessary interdisciplinary discussion that will be grounded in theory, legally and historically informed, and that despite its international orientation will not neglect national characteristics in- as well as outside the law.
++++++++++++++++++++ Krimmigration beschreibt die Verwobenheit zweier juristisch noch immer getrennt gedachter Rechtsgebiete: Die zunehmende Verschränkung von Strafrecht und Migrationsrecht. Ihr Effekt ist der Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen von einer vollwertigen Bürgerschaft und der Gesellschaft. Krimmigration ist zugleich Ursache und Folge eines gesellschaftlichen Diskurses, in dem die Konstruktion von Migration, des Fremden und Anderen mit Konstruktionen von Kriminalität, Unsicherheit und Gefahr einhergeht. Dieser Diskurs wird auf der politischen und medialen Bühne geführt, wobei verschiedene Moralunternehmer*innen auf unterschiedlichen Feldern Gefahren konstruieren, um diese Vermengung zu rechtfertigen. Der Diskurs bestimmt aber auch die alltägliche Praxis im Feld von Migration und Strafrecht, wobei die Grenzen zwischen Management und Kontrolle von Kriminalität einerseits und Migration andererseits, die Abgrenzung von strafrechtlichen Sanktionen zu Migrationssteuerung zunehmend verwischen bzw. sich auflösen. Eine wesentliche Folge in der Rechtswirklichkeit besteht im Verlust verfahrensrechtlicher Garantien mit Blick auf die diskursiven Praxen in der weitgehenden Identifikation von Kriminellem mit Fremdem.
Krimmigration als Gegenstand kriminologischer Forschung richtete sich demnach einerseits auf Gesetzgebung, ausführende Politik sowie Praxen der Überwachung und Kontrolle z.B. durch Handhabungen der Polizei und andererseits auf den gesellschaftspolitischen Kontext, der Krimmigration verursacht bzw. möglich macht und z.B. die Frage, auf welche Weise Kriminalitäts- und Migrationsthemen gesellschaftlich gerahmt werden.
Der Workshop zielt auf die juristischen sowie die gesellschaftspolitischen Debatten und auf deren auch transnationale Verwobenheit und historische Kontextualisierung.
„Kriminologie des Visuellen. Ordnungen des Sehens und der Sichtbarkeit im Kontext von Kriminalitätskontrolle und Sicherheitspolitiken“
– Bielefeld, 22.-23. März 2018 –
Visualisierungen gelten als ein Hinweis auf Relevanz. Erst wenn etwas sichtbar gemacht wird, kann man sich davon „ein Bild machen“, es einordnen, deuten und bewerten. Und umgekehrt: Über die Deutung und Bewertung eines diskursiven Phänomens werden Sichtbarkeiten produziert und damit Bilder erzeugt, die weiterwirken, neue Sinn- und Ordnungsangebote machen. Nicht ohne Grund wird von der „Macht der Bilder“ gesprochen. Dies gilt auch für die Thematisierung von Kriminalität und ihrer Kontrolle wie Beispiele spätestens seit dem 19. Jahrhundert zeigen: von der Rolle der Fotografie bei Bertillons Identifizierungssystem der ‚Verbrecherkartierung’ oder den Zeichnungen der geborenen Verbrecher und Verbrecherinnen bei Lombroso, über die Grafiken klassischer Theorien abweichenden Verhaltens, ihre Kurvenbilder und Infographiken bis zu den modernen Kartierungen städtischer Problemgebiete, den digital erzeugten Hirnbildern, die die vermeintlich abweichenden Areale unserer Gedanken farblich aufzuzeigen versuchen, den Videobildern aus Überwachungskontexten und den Amateuraufnahmen von Gewalt im Internet. Visualität, Visualisierung und Sichtbarkeit berühren Kernthemen kriminologischer Aushandlungen. Bei der ZiF-Arbeitsgruppe „Kriminologie des Visuellen“ ging es um Bilder der Kriminalität und der Kontrolle in einem doppelten Sinne: Einerseits beanspruchen Bilder die Realität so wiederzugeben wie sie tatsächlich ist. Mit ihnen wird auch innerhalb der kriminologischen Wissensproduktion ein Wahrheitsanspruch verbunden, der sie nicht nur geeignet macht als Beweis, sondern auch als eigentlicher Träger von Sinn und Evidenz zu wirken. Andererseits zielen Bilder als Repräsentationen auf eine exemplarische Verdeutlichung. Sie sind das Ergebnis einer selektiven Sichtbarmachung und einer produktiven Komposition, über die sie einen sozialen Sinn von dem erzeugen, was Kriminalität und Kriminalitätskontrolle sein und was oder wer als Gefahr wahrgenommen werden soll. Visualisierungen stecken Normalität ab, sie produzieren aber auch Feindbilder genauso wie Identifizierungen sowie affektive und moralische Überzeugungen. Die Arbeitsgemeinschaft beschäftigte sich mit den diversen Fragen, die diese Situation aufbringt: Wie, wann und zu welchem Zweck werden Bilder und andere Formen der Visualisierung produziert und wie ändert sich dies im Zeitverlauf? Welche Rolle spielt dabei die Entwicklung von Visualisierungstechnologien? Welche Effekte haben die Visualität und Visualisierung in der kriminal- und sicherheitspolitischen Praxis, bei ihrer gesellschaftlichen Kontrolle und in der Wissensproduktion? Weiteres findet sich unter: http://www.uni-bielefeld.de/(de)/ZIF/AG/2018/03-22-Groenemeyer.html
„Neu-Erfindungen wohlfahrtstaatlichen Strafens“
– Bielefeld, 7.-8. April 2016 –
Mit gegenwärtigen Konzepten und Praktiken „wohlfahrtsstaatlicher“ Reaktionen auf kriminalisiertes Verhalten beschäftigten sich im April 2016 rund 70 Kriminologinnen und Kriminologen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen während der Tagung „Neu-Erfindungen wohlfahrtsstaatlichen Strafens.“ Im Mittelpunkt stand die Frage, ob und in welchem Umfang wohlfahrtsstaatliches Handeln gegenwärtig noch den Umgang mit Kriminalität prägt, und welche Bedeutung anderen Maximen – wie etwa dem punitiven oder dem präventiven Denken innerhalb einer Sicherheitsideologie – zukommt. Neben Referaten und Diskussionen in fünf gut besuchten Arbeitskreisen standen Plenarvorträge von Heinz Cornel, Dagmar Ellerbrock, Ineke Pruin, Axel Groenemeyer, Nina Oelkers und Holger Ziegler auf dem Programm. Das Programm der Tagung ist hier einsehbar.
„Auf dem Weg zu einer sicheren Gesellschaft?“
– Bielefeld, 27.-29. März 2014 –
Der Bezug auf „Sicherheit“ ist zu einem konstitutiven Merkmal der öffentlichen, politischen und wissenschaftlichen Debatten über Kriminalität geworden. Die Trennung von innerer Sicherheit, äußerer Sicherheit und der Gewährleistung von sozialer Sicherheit galt dabei lange Zeit als Kerncharakteristikum einer modernen, rechtsstaatlichen Politik. In den letzten Jahren sind nicht nur diese Unterscheidungen diffuser geworden, Sicherheit ist zunehmend zu einer allgemeinen Referenzkategorie geworden, mit der unterschiedliche Bereiche und Phänomene des sozialen und öffentlichen Lebens gedeutet und als Bedrohungen problematisiert werden. Die Tagung „Auf dem Weg zu einer sicheren Gesellschaft?“ beschäftigte sich mit den Konsequenzen dieser Entwicklung für die Kriminologie.
„Devianz als Risiko“
– Siegen, 19.-21. September 2013 –
Seit einigen Jahren wird Kriminalität zunehmend als Risiko gedeutet, mit dem Politik, Öffentlichkeit, professionelle Akteure und auch potentielle Opfer umzugehen haben. Eine umfangreiche Debatte setzt sich mit den Folgewirkungen einer entsprechenden Rekodierung sozial auffälligen Verhaltens auseinander. Die Tagung „Devianz als Risiko“ in Siegen soll anhand von vier Ebenen analysieren, welche Veränderungen und Besonderheiten mit der Wahrnehmung von Devianz als sozialem Risiko verbunden sind.
„Einheitliches Recht für die Vielfalt der Kulturen?“
Die wesentlichen Beiträge von der Fachtagung der GiwK „Einheitliches Recht für die Vielfalt der Kulturen?“ sind Ende Januar 2012 in einem gleichnamigen Buch im LIT-Verlag erschienen. Mehr Informationen und eine Bestellmöglichkeit finden sich hier. Die Tagung in Zusammenarbeit mit dem IRKS Wien und dem Wiener Renner-Institut stand ganz im Zeichen der Internationalisierung des Kriminalrechts und der sich daraus ergebenden – oder dahinter stehenden – kulturellen Konflikte. Zentrales Thema waren die Konsequenzen veränderter Rechtsräume und eines zunehmend transnationalen Rechts für die Kriminologie und das Strafrecht.
„Kriminalität in der Krise“
– Deutungen und Bewältigungsstrategien in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Krisen –
29.-30. März 2012, Bielefeld
Ein ausgesprochen interdisziplinärer Teilnehmerkreis fand sich Ende März 2012 zu der vom GiwK-Vorstand organisierten Tagung „Kriminalität in der Krise“ in Bielefeld zusammen. Die seit nunmehr vier Jahren aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise nahm das Veranstalterteam zum Anlass, gesellschaftliche Strategien der Krisenbewältigung und ihre politischen, sozialen und rechtlichen Folgen zu untersuchen. Die Kriminologie, die schon per Selbstdefinition eine Disziplin der Krisenbewältigung ist, nimmt hierbei eine besondere Rolle ein. Untersucht werden sollte, welche Funktion klassischen kriminal- und sicherheitspolitischen Ordnungsinstanzen und entsprechenden Deutungsmustern (Schuld und Strafe, Opfer oder Täter, Gefahr und Sicherheit) zukommt im Verhältnis etwa zu wirtschaftspolitischen Steuerungsansätzen, aber auch zu alternativen Konzepten gesellschaftlicher Partizipation. Wesentlich geprägt wurde die Tagung durch Plenarvorträge von Christoph Scherrer (Kassel), Elmar Altvater (Berlin), Susanne Karstedt (Leeds), Christine Künzel, Ute Tellmann (Hamburg) und Stefan Kaufmann (Freiburg). Das Programm der Veranstaltung findet sich hier.
Tagungsbericht: „Cultural Criminology“
,Kultur‘ in ihren verschiedenen Verwendungskontexten tritt nicht erst in der jüngsten Zeit in den öffentlichen Diskursen auf. Die englischsprachige Kriminologie agiert bereits seit einigen Jahren mit Erfolg auf dieser Bühne, während sich die deutschsprachige Kriminologie erst spät, mit Widerständen und deshalb eher zurückhaltend auf dieses Feld begeben hat. Dabei hat der Etikettierungsansatz, darunter vor allem auch die in der deutschsprachigen Kriminologie thematisierte Variante dieses Ansatzes, im Rahmen von Erörterungen der Formationsprozesse von Kriminalitätsdiskursen bereits frühzeitig zu den kulturellen De- und Konnotationen dessen Stellung bezogen, was als ,abweichendes Verhalten‘ kenntlich gemacht wird. ,Cultural Criminology‘ führt unterschiedliche disziplinäre Perspektiven zusammen. In der englischsprachigen Kriminologie bildet ,Cultural Criminology‘ ein Arbeitsverständnis verschiedener kultur- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen (Kriminologie, Soziologie, Anthropologie, Geschichtswissenschaften, Literaturwissenschaften). Anlässlich des von der GiwK veranstalteten Kolloquiums wurden Ansätze und Positionen einer deutschsprachigen ,Cultural Criminology‘ anhand der folgenden Vorträge erörtert:
- Sascha Schierz (Vechta)/Herbert Reinke (Berlin): Kultur, Cultural Studies, Cultural Criminology. Eine Annäherung
- Bernd Dollinger (Freiburg/Br.): ,Cultural Criminology‘ und das Problem ,sozialer Tatsachen‘. Innovationspotenziale kriminologischer Kulturtheorie
- Andrea Kretschmann (Wien): Cultural Criminology in gouvernementaler Perspektive
- Michael Jasch (Frankfurt/Main): ,Leitkultur Strafrecht‘?
- Aldo Legnaro: Gehen-Raum-Kontrolle. Reflexionen über das Flanieren und über makrosoziologische Regierungsstrukturen
- Eva Erdmann (Konstanz): Tatorte zwischen politischer, geographischer und belletristischer Phantasie
- Katja Geiger (Wien): Die Materialisierung von Verbrechensbildern in der gerichtlichen Medizin – das Beispiel Kindesmord (ca. 1900 – 1930).
Tagungsbericht: „Gefährliche Menschenbilder“
Bio-Wissenschaften, Gesellschaft und Kriminalität
27. bis 29. März 2008, Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) Bielefeld
Die Lebenswissenschaften, insbesondere die neurobiologische Hirnforschung, präsentieren der staunenden Gesellschaft gegenwärtig neue Perspektiven auf den Menschen. Nicht zuletzt meinen sie mit ihren Erkenntnissen und Methoden „gefährliche“ von „ungefährlichen“ Menschen unterscheiden zu können. Spätestens hier stellt sich die Frage, ob es um „Bilder gefährlicher Menschen“ oder um „gefährliche Menschenbilder“ geht. Mehr Informationen hier
